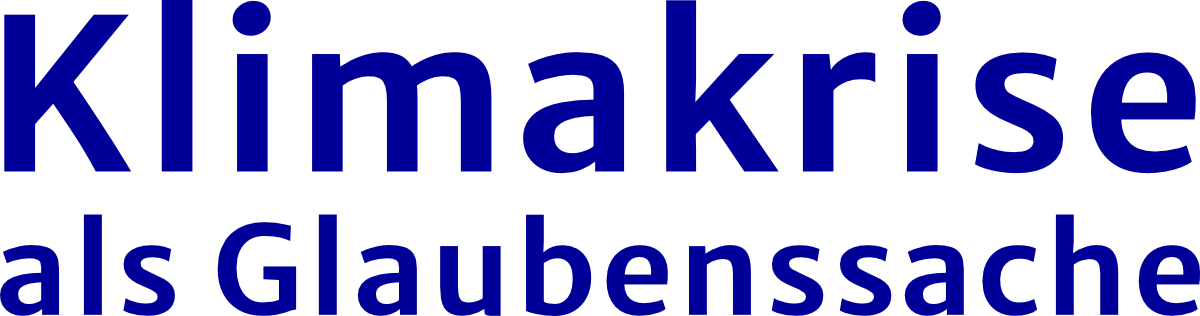Vertiefungen zum Buch
Dieser Studienführer dient zum Verständnis des Buches „Klimakrise als Glaubenssache – Wie Denkwelten unser Engagement ausbremsen oder unterstützen“.
Er bietet eine Zusammenfassung der Hauptthesen, eine Liste von Schlüsselkonzepten, Übungsfragen zur Überprüfung des Verständnisses, Vorschläge für Essay-Aufgaben und ein ausführliches Glossar.
Hauptthesen des Buchs
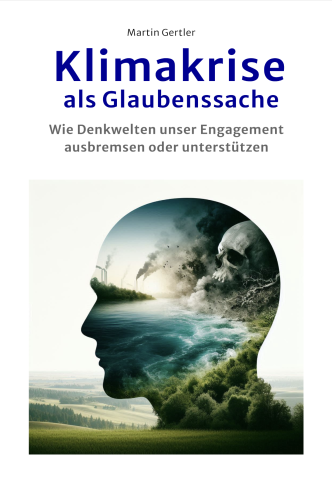
Im Buch „Klimakrise als Glaubenssache – Wie Denkwelten unser Engagement ausbremsen oder unterstützen“ wird argumentiert, dass die Bewältigung der Klimakrise nicht nur ein ökologisches und politisches, sondern in erheblichem Maße auch ein weltanschauliches Problem darstellt. Die mangelnde Umsetzung wissenschaftlich definierter Handlungsanforderungen wird auf tief verwurzelte Denkmuster und normative Leitbilder zurückgeführt.
Der Autor entwickelt ein zweistufiges Bewertungsraster, um die Anschlussfähigkeit verschiedener weltanschaulicher Denkmodelle an klimawissenschaftliche Anforderungen und deren Transformationspotenzial zu analysieren. Er identifiziert vier paradigmatische Denkmodelle: Ökonomismus, Religionismus, Humanismus und Veganismus.
Die zentrale Forschungsfrage lautet, wie diese unterschiedlichen Denkmodelle methodisch vergleichbar gemacht werden können, um ihr Potenzial zur Förderung oder Blockierung gesellschaftlicher Transformation in der Klimakrise zu analysieren.
Die Untersuchung zeigt, dass jedes Denkmodell spezifische Stärken und Schwächen im Umgang mit der Klimakrise aufweist:
- Ökonomismus
Fokussiert auf Markt, Effizienz und Wachstum. Akzeptiert klimapolitische Maßnahmen nur, wenn sie wirtschaftlich vorteilhaft oder technologiebasiert sind. Zeigt geringe Bereitschaft zu grundlegenden Systemveränderungen und neigt dazu, moralische und soziale Aspekte auszublenden. Ängste vor wirtschaftlichem Abstieg hemmen Engagement. - Religionismus
Bietet starke moralische und normative Anker durch Konzepte wie Schöpfungsbewahrung und Gerechtigkeit. Potenzial zur kollektiven Mobilisierung, aber auch interne Ambivalenzen (z.B. Anthropozentrismus vs. Biozentrismus, Jenseitsfokus) und institutionelle Trägheit können die Umsetzung hemmen. Ängste vor dem Verlust traditioneller Werte sind relevant. - Humanismus
Betont Vernunft, Autonomie, Menschenwürde und globale Verantwortung. Ist offen für wissenschaftliche Erkenntnisse und plädiert für Bildung und rationale Diskurse. Neigt jedoch zur Individualisierung von Verantwortung und kann strukturelle Machtverhältnisse unterschätzen. Ängste vor Überforderung und Kontrollverlust können das Engagement hemmen. - Veganismus
Eine radikal ethische Position, die die Instrumentalisierung von Tieren ablehnt und eine umfassende Systemkritik an anthropozentrischen und wachstumsorientierten Strukturen übt. Hohe Handlungsmotivation und Anschlussfähigkeit an systemische Klimakritik, aber Gefahr der sozialen Exklusivität und eines hohen moralischen Anspruchs. Ängste vor sozialer Ausgrenzung sind prägnant.
Die Anwendung des entwickelten Rasters auf den Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung (2025) zeigt exemplarisch, dass dieser stark vom ökonomistischen Denkmodell geprägt ist, wodurch eine tiefgreifende, wissenschaftlich fundierte Klimatransformation nur selektiv adressiert wird.
Insgesamt betont die Untersuchung, dass eine wirksame Klimapolitik eine tiefgehende Auseinandersetzung mit diesen weltanschaulichen Rahmenbedingungen erfordert, da sie maßgeblich die Wahrnehmung, Bewertung und Umsetzung von klimapolitischen Maßnahmen prägen.
Schlüsselkonzepte
- Denkwelt: Umfassender weltanschaulicher Rahmen, der Wahrnehmung, Bewertung und Handlungsorientierung strukturiert. Umfasst Überzeugungen, Werte, Normen und Annahmen einer Person oder Gruppe.
- Denkmodell: Eine strukturierende Vorstellung innerhalb einer Denkwelt zur Erfassung komplexer Zusammenhänge. Vereinfachende Konstrukte zur Analyse, Erklärung oder Begründung von Handlungsweisen.
- Ökonomistisches Denkmodell: Eine weltanschauliche Strömung, die ökonomische Kategorien (Markt, Effizienz, Wachstum, Wettbewerb, Innovation) als primär für die Erklärung und Steuerung gesellschaftlicher Phänomene ansieht.
- Religionistisches Denkmodell: Eine weltanschauliche Strömung, die Weltverstehen, Sinnstiftung und moralische Orientierung wesentlich durch religiöse Deutungsmuster prägt (z.B. Schöpfungsbewahrung, Gerechtigkeit, Jenseitsbezug).
- Humanistisches Denkmodell: Eine kulturelle und ethische Bewegung, die Vernunft, Freiheit, Autonomie, Menschenwürde und Verantwortung als leitende Prinzipien begreift. Vertraut auf rationale Erkenntnis und moralisches Handeln.
- Veganistisches Denkmodell: Eine weltanschauliche Position, die auf der moralischen Ablehnung der Instrumentalisierung von Tieren basiert und eine umfassende Kritik an anthropozentrischen und ausbeuterischen Systemen übt. Verbindet individuelle Lebensführung mit struktureller Kritik.
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Der Weltklimarat, ein internationales Gremium, das den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel evaluiert und Berichte für die globale Klimapolitik liefert.
- CO₂-Budget: Die Gesamtmenge an Kohlenstoffdioxid, die die Menschheit noch emittieren darf, um mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein festgelegtes Temperaturziel nicht zu überschreiten.
- Planetare Grenzen: Ein Konzept, das neun kritische Prozesse des Erdsystems identifiziert, deren Überschreitung das stabile Umfeld des Holozäns gefährdet und irreversible Umweltveränderungen riskiert.
- Sustainable Development Goals (SDG): 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden, um ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu verknüpfen.
- Engagement: Die Bereitschaft und Fähigkeit eines weltanschaulichen Rahmens, individuelle oder kollektive Handlungsimpulse in Bezug auf die Klimakrise zu generieren.
- Transformationspotenzial: Die innere Konsistenz, Reichweite und systemische Anschlussfähigkeit eines weltanschaulichen Rahmens in Bezug auf die erforderlichen Veränderungen zur Bewältigung der Klimakrise.
- Blinde Flecken: Systematisch nicht beachtete Konfliktlagen, ethische Inkonsistenzen oder kognitive Auslassungen innerhalb eines Denkmodells.
- Angstbasierte Hemmnisse: Emotionale Barrieren, die potenziell vorhandene Handlungsmotivation blockieren (z.B. Überforderungsgefühle, Identitätsbedrohung, soziale Abgrenzungsangst).
- Speziesismus: Die ideologische Bevorzugung des Menschen gegenüber anderen Lebewesen, ähnlich wie Rassismus oder Sexismus.
Quiz
Nachfolgend finden Sie zehn kurze Fragen und entsprechende kurze Antworten. Damit können Sie Ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem Buch, seinen Methoden und Ergebnissen vertiefen und Ihre eigene Fachkompetenz erweitern!
1. Was versteht der Autor unter „Klimakrise als Glaubenssache“ und welche Hypothese leitet er daraus ab?
Er argumentiert, dass die Klimakrise nicht nur ein ökologisches und politisches, sondern auch ein tiefgreifendes weltanschauliches Problem ist. Er leitet die Hypothese ab, dass die zögerliche Umsetzung klimawissenschaftlicher Anforderungen auf tief verwurzelte Denkmuster und normative Leitbilder zurückzuführen ist.
2. Erläutern Sie den Unterschied zwischen „Denkwelt“ und „Denkmodell“ im Kontext des Buches.
Eine „Denkwelt“ ist ein umfassender weltanschaulicher Rahmen, der die gesamte Wahrnehmung, Bewertung und Handlungsorientierung einer Gruppe strukturiert. Ein „Denkmodell“ hingegen ist eine spezifischere, strukturierende Vorstellung innerhalb dieser Denkwelt, die dazu dient, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und Handlungsweisen zu erklären oder zu begründen.
3. Welche Rolle spielen der IPCC und das CO₂-Budget für die „unabhängige Variable“ in Gertlers Untersuchung?
Der IPCC und das CO₂-Budget bilden die „unabhängige Variable“ in Gertlers Untersuchung, da sie den normativen und systemischen Referenzrahmen für die Analyse darstellen. Sie liefern die wissenschaftlich fundierten Anforderungen und quantitativen Grenzen, an denen die verschiedenen Denkmodelle gemessen werden.
4. Nennen Sie zwei typische Positionen des ökonomistischen Denkmodells und erklären Sie kurz, wie diese klimapolitisches Engagement beeinflussen können.
Typische Positionen sind: 1) Klimapolitik soll sich dem wirtschaftlichen Erfolgsprinzip unterordnen (z.B. grünes Wachstum), was dazu führen kann, dass Maßnahmen nur bei gleichzeitiger Rentabilität umgesetzt werden. 2) Klimapolitik wird als technisches Optimierungsproblem verstanden, was die Suche nach technologischen Lösungen priorisiert und systemische Veränderungen des Lebensstils vernachlässigt.
5. Welche „blinden Flecken“ werden dem religionistischen Denkmodell zugeschrieben und wie können diese das Engagement hemmen?
Dem religionistischen Denkmodell werden unter anderem ein stark anthropozentrisches Weltbild und der Dualismus von Welt und Jenseits als blinde Flecken zugeschrieben. Diese können das Engagement hemmen, indem sie die Eigenwertigkeit der Natur überlagern oder das Engagement für irdische Lebensgrundlagen als nachrangig erscheinen lassen, wenn das „eigentliche Leben“ erst nach dem Tod beginnt.
6. Beschreiben Sie, wie das humanistische Denkmodell mit „Selbstwirksamkeit“ umgeht und welche Angst es in diesem Kontext dennoch zeigen kann.
Das humanistische Denkmodell betont Selbstwirksamkeit durch Bildung, Reflexion und Engagement, indem es vermittelt: „Du kannst denken, handeln, gestalten.“ Dennoch kann es die Angst vor Überforderung angesichts der Komplexität der Klimakrise zeigen, da die hohe Erwartung an individuelle Wirksamkeit frustrierend sein kann, wenn sich keine sichtbaren Effekte einstellen.
7. Welches sind die zentralen Werte des veganistischen Denkmodells und inwiefern führen diese zu einer „radikalen Neudeutung“?
Die zentralen Werte des veganistischen Denkmodells sind Mitgefühl, Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und ökologische Verantwortung. Sie führen zu einer „radikalen Neudeutung“, indem sie die moralische Gleichheit fühlender Lebewesen über Speziesgrenzen hinweg anerkennen und somit eine fundamentale Kritik an der Instrumentalisierung von Tieren und anthropozentrischen Systemen formulieren.
8. Wie unterscheidet sich die „Alltagsrelevanz“ im ökonomistischen und im veganistischen Denkmodell in Bezug auf Klimahandeln?
Im ökonomistischen Denkmodell wird Alltagsrelevanz indirekt über Preisreize und Marktverhalten adressiert („Wenn Strom teurer wird, sparen die Leute“), ohne tiefe emotionale oder soziale Resonanz. Das veganistische Denkmodell hingegen ist alltagsnah par excellence, indem es Ernährung, Einkaufen, Kleidung und Mobilität als direkte Bereiche ethischer Intervention und Transformation im Alltag versteht.
9. Welche Schlussfolgerung zieht der Autor aus der Anwendung seines Bewertungsrasters auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2025?
Er folgert, dass der Koalitionsvertrag stark vom ökonomistischen Weltbild geprägt ist, was sich in der Priorisierung von Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Dies führt dazu, dass zentrale Anforderungen der Klimawissenschaft nur punktuell und selektiv aufgegriffen, aber keine ganzheitliche und tief verankerte Transformationsstrategie verfolgt wird.
10. Warum sind laut Gertler „blinde Flecken“ und „angstbasierte Hemmnisse“ trotz ihrer Nicht-Quantifizierung im Raster wichtig für das Verständnis weltanschaulicher Transformationsfähigkeit?
Sie sind wichtig, weil sie Aufschluss über unbeabsichtigte Begrenzungen und emotionale Barrieren geben, die transformativem Handeln im Wege stehen können. Sie sind strukturimmanente Schwächungen, die aus den jeweiligen normativen Prägungen hervorgehen und die Differenz zwischen deklarierter Absicht und tatsächlicher Wirksamkeit beeinflussen.
Essay-Aufgaben
- Diskutieren Sie kritisch das Transformationspotenzial des ökonomistischen Denkmodells im Kontext der Klimakrise. Welche Stärken und Schwächen identifiziert der Text des Buches, und inwiefern sind seine „blinden Flecken“ strukturell bedingt und relevant für die Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen?
- Analysieren Sie die Ambivalenzen des religionistischen Denkmodells hinsichtlich seiner Rolle in der Klimatransformation. Inwiefern kann es mobilisierend wirken, und welche inneren Spannungen oder „Ängste“ können sein Engagement hemmen? Beziehen Sie sich dabei auf konkrete Beispiele aus dem Text des Buches.
- Vergleichen und kontrastieren Sie die humanistische und veganistische Denkwelt in Bezug auf ihre Anschlussfähigkeit an die Anforderungen einer tiefgreifenden sozial-ökologischen Transformation. Wo liegen ihre jeweiligen Stärken und Schwächen, und wie gehen sie mit dem Spannungsfeld zwischen individueller Verantwortung und systemischem Wandel um?
- Der Buchtext stellt fest: „Weltanschauliche Modelle prägen die Wahrnehmung und Bewertung klimapolitischer Anforderungen in spezifischer Weise.“ Erläutern Sie diese Aussage anhand von mindestens zwei der beschriebenen Denkmodelle und diskutieren Sie, welche Implikationen dies für die politische Kommunikation und Bildungsarbeit im Kontext der Klimakrise hat.
- Gertler schlägt ein „Modell weltanschaulicher Transformationsfähigkeit“ vor, das Engagement und Transformationspotenzial gegenüberstellt. Diskutieren Sie dieses Modell kritisch. Welche Dimensionen erfasst es gut, welche Grenzen weist es auf, und wie könnten „blinde Flecken“ und „angstbasierte Hemmnisse“ darin integriert werden, um seine analytische Aussagekraft zu erhöhen?
Glossar der Schlüsselbegriffe
- Abstrakter Horizont: Ein unbestimmter, ferner Bereich oder eine Idee, die nicht konkret oder unmittelbar greifbar ist.
- Abstrakte Hinweise: Allgemeine, nicht spezifische Empfehlungen oder Angaben.
- Abschreckende Maßnahmen: Maßnahmen, die darauf abzielen, unerwünschtes Verhalten durch negative Konsequenzen zu verhindern.
- Adaptation: Anpassung an unvermeidliche Auswirkungen des Klimawandels.
- Affektiv: Emotional, die Gefühle betreffend oder beeinflussend.
- Aggregiert: Zusammengefasst, als Ganzes betrachtet oder in einer größeren Menge gesammelt.
- Agrarförderung: Staatliche Unterstützung für die Landwirtschaft.
- Agrarsubventionen: Finanzielle Hilfen des Staates an landwirtschaftliche Betriebe.
- Allokation: Verteilung von Ressourcen.
- Alltagsrelevanz: Die Bedeutung oder Anwendbarkeit einer Sache im täglichen Leben.
- Ambivalenzen: Doppeldeutigkeiten oder widersprüchliche Gefühle/Haltungen.
- Ambiguitätstoleranz: Die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten, Widersprüche oder Unsicherheiten auszuhalten, ohne sich dadurch gestört zu fühlen oder eine schnelle Lösung zu suchen.
- Analyseinstrument: Ein Werkzeug oder Rahmen, das zur systematischen Untersuchung und Bewertung von Daten oder Konzepten dient.
- Anschlussfähigkeit: Die Fähigkeit eines Konzepts oder Modells, an bestehende Diskurse, Strukturen oder Denkmuster anzuknüpfen und sich in diese zu integrieren.
- Anthropozentrisch: Den Menschen als Mittelpunkt oder Maßstab aller Dinge betrachtend.
- Antirassistisch: Gegen Rassismus gerichtet.
- Appellativ: Eine Aussage oder Botschaft, die als Aufruf oder Aufforderung formuliert ist.
- Asketisch: Eine Lebensweise, die durch Enthaltsamkeit und Verzicht geprägt ist.
- Assymmetrisch: Nicht gleichmäßig verteilt oder nicht im Gleichgewicht.
- Aushandlungsfeld: Ein Bereich, in dem unterschiedliche Interessen oder Positionen durch Verhandlung und Kompromissbildung ausgeglichen werden müssen.
- Aushöhlung ethischer Klarheit: Der Verlust der moralischen Eindeutigkeit oder Strenge durch äußere Einflüsse oder Kompromisse.
- Autonomie: Selbstbestimmung, Unabhängigkeit.
- Autonomiekonflikte: Spannungen, die entstehen, wenn individuelle Selbstbestimmung mit äußeren Anforderungen oder kollektiven Notwendigkeiten kollidiert.
- Binnenkontext: Der interne oder innere Rahmen eines Systems oder einer Gruppe, der die eigenen Prozesse und Beziehungen betrifft.
- Biozentrisch: Das Leben und die Natur als Ganzes in den Mittelpunkt stellend.
- Biosphärenintegrität: Die Unversehrtheit und Funktionsfähigkeit der Biosphäre, also des Teils der Erde, in dem Leben existiert.
- CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism): Ein geplanter Mechanismus der EU zur Bepreisung von Emissionen importierter Waren, um Carbon Leakage zu verhindern.
- CCS (Carbon Capture and Storage): Technologie zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid.
- Challenges: Aufgaben oder Herausforderungen, die dazu anregen, bestimmtes Verhalten auszuprobieren oder zu ändern.
- Chancengleichheit: Gerechte Möglichkeiten für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder Situation.
- Degrowth (Postwachstum): Ein Konzept, das eine geplante Reduktion des Wirtschaftswachstums und des Konsums anstrebt, um ökologische und soziale Ziele zu erreichen.
- Dekarbonisierung: Die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, insbesondere CO₂, in der Wirtschaft.
- Dekonstruktion: Eine kritische Analyse, die darauf abzielt, die verborgenen Annahmen und Machtstrukturen in Texten oder Konzepten aufzudecken.
- Denklogiken: Die spezifischen Muster und Regeln, nach denen in einem Denkmodell argumentiert und geschlossen wird.
- Depolitisierung: Der Prozess, bei dem politische Fragen aus dem öffentlichen Diskurs genommen und als technisch, wirtschaftlich oder privat dargestellt werden, um politische Aushandlung zu vermeiden.
- Dichotomie: Eine Zweiteilung oder Entgegensetzung von Konzepten.
- Differenzlinien: Die Grenzen oder Unterscheidungen zwischen verschiedenen Ansätzen oder Perspektiven.
- Differenzierte Ethik: Eine moralische Beurteilung, die kontextsensibel ist und unterschiedliche Perspektiven sowie Kriterien berücksichtigt, anstatt starren Regeln zu folgen.
- Digitale Gründerschutzzonen: Spezielle Bereiche, die darauf abzielen, Start-ups im Bereich digitaler Technologien zu fördern und zu schützen.
- Dirigistisch: Eine Politik oder Haltung, die auf starker staatlicher Lenkung und Kontrolle beruht.
- Diskursanalysen: Eine Methode, die Sprache und Kommunikation untersucht, um die Art und Weise zu verstehen, wie soziale Realitäten konstruiert und vermittelt werden.
- Diskursorientiert: Darauf ausgerichtet, durch Dialog und Diskussion zu Erkenntnissen oder Entscheidungen zu gelangen.
- Diskursraum: Der Bereich, in dem bestimmte Themen, Argumente und Narrative öffentlich verhandelt und ausgetauscht werden.
- Diskurssichtbarkeit: Die öffentliche Präsenz und Rezeption von Quellen oder Beiträgen in gesellschaftlichen Debatten.
- Dogma: Ein festgelegter Lehrsatz oder Glaubensgrundsatz, der nicht in Frage gestellt werden darf.
- Donut-Ökonomie: Ein Modell, das wirtschaftliche Aktivität innerhalb planetarer Grenzen und sozialer Mindeststandards ansiedelt.
- Dualismus: Eine philosophische oder theologische Lehre, die zwei voneinander unabhängige und gegensätzliche Prinzipien annimmt, z.B. Geist und Materie, Welt und Jenseits.
- Dynamische Trias: Eine Gruppe von drei Elementen, die in ständiger Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig beeinflussen.
- Egalitär: Gleichheit betonend oder anstrebend.
- Eigenwertigkeit der Natur: Die Auffassung, dass die Natur einen intrinsischen Wert besitzt, unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen.
- Einschränkung unternehmerischer Handlungsfreiheit: Die Begrenzung der Möglichkeiten für Unternehmen, frei zu agieren, oft durch staatliche Regulierungen oder Auflagen.
- Emissionen: Ausstoß von Gasen oder Stoffen in die Atmosphäre.
- Emissionshandel (ETS): Ein marktbasiertes Instrument zum Klimaschutz, bei dem Unternehmen Verschmutzungsrechte handeln können.
- Empathie: Die Fähigkeit, sich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen.
- Empowerment-Debatten: Diskussionen über die Stärkung von Individuen oder Gruppen, um ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihr Leben gestalten zu können.
- Entideologisieren: Den Prozess, bei dem ein Thema von ideologischen Vorannahmen oder Dogmen befreit und neutraler betrachtet wird.
- Entpersonalisierung: Der Verlust der persönlichen oder individuellen Dimension, wodurch etwas als abstrakt oder systemisch betrachtet wird.
- Entzeitlichen: Etwas aus seinem zeitlichen Kontext lösen oder es als zeitlos darstellen, wodurch die Dringlichkeit oder die historischen Bedingungen relativiert werden.
- Epidemische Lücke: Eine fehlende oder unzureichende Erkenntnis in einem Wissensgebiet, die zu mangelhaftem Verständnis oder Fehlentscheidungen führen kann.
- Ethik des Radikalen Digitalen Humanismus: Ein ethischer Ansatz, der die menschliche Würde und Autonomie im Kontext digitaler Technologien betont und radikale Veränderungen fordert.
- Ethische Kohärenz: Die innere Stimmigkeit und Konsistenz moralischer Prinzipien und Handlungen.
- Ethische Neuanfänge: Eine grundlegende Neuorientierung moralischer Prinzipien oder Wertvorstellungen.
- Ethische Selbstbindung: Eine freiwillige Verpflichtung zu moralischen Prinzipien, die aus innerer Überzeugung und Rationalität resultiert.
- Ethischer Naturalismus: Ein ethischer Ansatz, der moralische Werte und Normen aus natürlichen Eigenschaften des Menschen oder der Welt ableitet, ohne metaphysische oder religiöse Begründungen.
- Ethnozentrismus: Die Tendenz, die eigene Kultur oder Gruppe als Maßstab für die Bewertung anderer Kulturen oder Gruppen zu nehmen.
- Eurozentrisch: Eine Denkweise, die Europa oder die europäische Kultur als Mittelpunkt der Welt und als Maßstab für andere Kulturen betrachtet.
- Evidenzbasierte Rahmensetzungen: Regelungen oder Richtlinien, die auf wissenschaftlichen Beweisen und Daten basieren.
- Exklusionsmechanismen: Prozesse, die bestimmte Personen oder Gruppen aus gesellschaftlichen Teilbereichen ausschließen.
- Explorativ: Erforschend, darauf abzielend, neue Erkenntnisse zu gewinnen oder ein Phänomen zu untersuchen, ohne vorherige Hypothesen zu bestätigen.
- Externalisierung ethischer Verantwortung: Das Verlagern moralischer Verantwortung für Handlungen oder deren Folgen auf Dritte oder auf abstrakte Systeme.
- Exzess: Übermaß, extreme Überschreitung eines Maßes.
- Faktisch-rational: Auf Fakten und Vernunft basierend, objektiv und logisch.
- Faktisches Wissen: Wissen, das auf Tatsachen und empirischen Daten basiert.
- Fair Fashion: Kleidung, die unter fairen Arbeitsbedingungen und umweltfreundlich hergestellt wird.
- Feministisch-ökonomische Care-Ansätze: Wirtschaftliche Theorien, die die Bedeutung von Fürsorgearbeit und reproduktiver Arbeit für die Gesellschaft hervorheben und kritisieren, dass diese oft unbezahlt oder unterbezahlt ist.
- Fermentation: Ein Stoffwechselprozess, bei dem organische Stoffe durch Mikroorganismen umgewandelt werden, z.B. bei der Herstellung von Lebensmitteln.
- Fokus auf Individualisierung: Die Tendenz, gesellschaftliche Probleme primär als Resultat individuellen Verhaltens zu interpretieren, anstatt systemische Ursachen zu berücksichtigen.
- Formelle Legitimität: Die offizielle Anerkennung oder Gültigkeit, die auf rechtlichen oder institutionellen Verfahren beruht.
- Fortschrittsglaube: Die Überzeugung, dass die Entwicklung der Menschheit und ihrer Gesellschaften kontinuierlich positiv verläuft und zu einer Verbesserung führt.
- Frame-Analysen: Eine Methode zur Untersuchung von Interpretationsrahmen in der Kommunikation.
- Freireligiöse Aktivitäten: Religiöse oder spirituelle Praktiken, die außerhalb traditioneller kirchlicher Strukturen stattfinden und oft eine liberale, undogmatische Ausrichtung haben.
- Funktional-instrumentell: Eine Betrachtungsweise, die etwas primär nach seiner Nützlichkeit oder Effizienz zur Erreichung eines bestimmten Ziels bewertet.
- Funktionalisiert: Auf eine bestimmte Funktion oder Nützlichkeit reduziert.
- Funktionale Erzählung: Eine Geschichte oder Darstellung, die primär auf die Beschreibung von Prozessen oder Systemen abzielt, nicht auf emotionale oder persönliche Aspekte.
- Funktionale Grundannahmen: Annahmen, die sich auf die Funktionsweise von Systemen oder Prozessen beziehen und deren Effizienz oder Zweckmäßigkeit betonen.
- Funktionales Instrument: Ein Werkzeug oder eine Maßnahme, die auf ihre Wirksamkeit oder ihren Nutzen hin bewertet wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
- Ganzheitliche Ökologie: Ein Konzept, das Umweltprobleme nicht isoliert, sondern in ihrer engen Verbindung mit sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten betrachtet.
- Geltungsethik: Eine Ethik, die sich auf die universelle Gültigkeit moralischer Normen und Prinzipien konzentriert, unabhängig von kulturellen oder individuellen Vorlieben.
- Gemeinwohl: Das Wohl der gesamten Gemeinschaft oder Gesellschaft.
- Gemeinschaftsverpflegung: Die Versorgung mit Speisen in größeren Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern oder Unternehmen.
- Generationenübergreifend: Über mehrere Generationen hinweg reichend oder diese betreffend.
- Geistlicher Prozess: Ein Prozess der inneren, spirituellen Entwicklung oder Umwandlung.
- Gerechte Mobilitätssysteme: Verkehrssysteme, die allen Menschen gleiche Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten bieten, unabhängig von ihrem sozialen oder wirtschaftlichen Status.
- Geringe Ambiguitätstoleranz: Eine geringe Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten oder Widersprüche auszuhalten.
- Global Citizenship: Das Konzept, sich als Bürger der Welt zu verstehen und globale Verantwortung zu übernehmen.
- Globale Governance: Das Zusammenspiel von Regeln, Institutionen und Akteuren auf globaler Ebene, um grenzüberschreitende Probleme zu lösen.
- Globale Lieferketten: Netzwerke von Unternehmen und Prozessen, die Produkte von der Rohstoffgewinnung bis zum Endverbraucher über nationale Grenzen hinweg transportieren.
- Globale Machtasymmetrien: Ungleiche Verteilungen von Macht und Einfluss auf globaler Ebene, die zu Ungerechtigkeiten führen können.
- Globale Verantwortung: Die moralische Verpflichtung, über nationale oder lokale Interessen hinauszudenken und sich für das Wohlergehen des gesamten Planeten und seiner Bewohner einzusetzen.
- Globaler Süden: Begriff, der sich auf Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen bezieht, die historisch oft von Kolonialismus betroffen waren und im globalen Kontext benachteiligt sind.
- Grüne Anleihen: Finanzprodukte, die zur Finanzierung von Projekten mit positiven Umweltauswirkungen dienen.
- Grüner Kapitalismus: Eine Wirtschaftsform, die versucht, Umweltschutz mit Wirtschaftswachstum zu vereinbaren, oft durch technologische Innovationen und marktbasierte Lösungen.
- Grüne Pioniere: Unternehmen oder Individuen, die frühzeitig nachhaltige Praktiken oder Technologien einführen und damit neue Wege aufzeigen.
- Grüne Theologie: Ein theologischer Ansatz, der ökologische Themen und die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt religiöser Lehre und Praxis rückt.
- Heilsgeschichtliche Narrative: Erzählungen, die die Geschichte als Teil eines göttlichen Plans oder einer Heilsgeschichte interpretieren.
- Heuristische Tragfähigkeit: Die Fähigkeit eines Modells oder Konzepts, neue Erkenntnisse zu generieren oder die Forschung voranzutreiben, auch wenn es nicht perfekt oder vollständig ist.
- Heuristisch ergiebig: Die Fähigkeit eines Ansatzes, fruchtbare Anregungen für die Erkenntnisgewinnung zu liefern.
- Holistich: Ganzheitlich, alle Aspekte umfassend.
- Homo oeconomicus: Ein idealisiertes Modell des Menschen in der Wirtschaftswissenschaft, das ihn als rational kalkulierendes, eigennutzorientiertes Individuum darstellt.
- Hybris: Übermut, Anmaßung oder Hochmut, oft in Bezug auf eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten oder Macht.
- Hybride Positionen: Positionen, die Elemente aus verschiedenen Denkmodellen oder Weltanschauungen miteinander verbinden.
- Idealtypische Rangfolge: Eine hierarchische Anordnung, die auf idealisierten, vereinfachten Merkmalen basiert und nicht unbedingt die Realität abbildet.
- Identitätsbedrohung: Eine Bedrohung für das Selbstverständnis oder die Identität einer Person oder Gruppe.
- Identitätsstiftend: Etwas, das zur Bildung oder Festigung der Identität einer Person oder Gruppe beiträgt.
- Ideologisch gesetzt: Eine Annahme oder ein Prinzip, das aufgrund einer bestimmten Ideologie als gegeben oder richtig angesehen wird.
- Inhärent: Innewohnend, als fester Bestandteil einer Sache.
- Inkongruenz: Mangel an Übereinstimmung oder Harmonie.
- Inkorporiert: Eingegliedert, inkorporiert, in eine Einheit aufgenommen.
- Innovation als Allzwecklösung: Die Überzeugung, dass technologische oder wirtschaftliche Neuerungen alle Probleme lösen können, ohne dass grundlegende Veränderungen notwendig sind.
- Innovationsglaube: Der Glaube an die Fähigkeit von Innovationen, Probleme zu lösen und Fortschritt zu ermöglichen.
- Instrumentalisierung von Tieren: Die Nutzung von Tieren als bloße Mittel zur Erfüllung menschlicher Zwecke, ohne Rücksicht auf ihr Eigenwohl.
- Integraler Bestandteil: Ein untrennbarer, wesentlicher Teil einer größeren Einheit.
- Intergenerationell: Über mehrere Generationen hinweg reichend oder diese betreffend.
- Intergenerationelle Gerechtigkeit: Die gerechte Verteilung von Ressourcen, Chancen und Lasten zwischen verschiedenen Generationen.
- Internalisierung externer Effekte: Die Einbeziehung von Kosten oder Nutzen, die nicht direkt im Marktpreis enthalten sind (z.B. Umweltverschmutzung), in die ökonomische Kalkulation.
- Internationale Benchmarking: Der Vergleich der eigenen Leistung mit der international besten Praxis, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
- Intersektional: Eine Perspektive, die verschiedene Formen von Diskriminierung und Ungleichheit (z.B. aufgrund von Geschlecht, Rasse, Klasse) als miteinander verknüpft betrachtet.
- Intersubjektiv: Zwischen Subjekten oder Personen bestehend, gemeinsam von mehreren geteilt oder nachvollziehbar.
- Investitionslenkung: Die gezielte Steuerung von Finanzmitteln in bestimmte Bereiche, oft durch staatliche Anreize oder Regulierungen.
- Irrational: Nicht vernünftig, unlogisch.
- Kanon: Eine Sammlung von als verbindlich oder vorbildlich angesehenen Texten, Werken oder Prinzipien.
- Karitativ: Wohltätig, auf Nächstenliebe und Hilfe für Bedürftige ausgerichtet.
- Kipppunkte: Schwellenwerte in komplexen Systemen (z.B. Klima), deren Überschreitung zu abrupten und oft irreversiblen Veränderungen führt.
- Kirchenkonstruktion: Die Art und Weise, wie eine Kirche als Institution strukturiert und organisiert ist, einschließlich ihrer Beziehungen zum Staat und zur Wirtschaft.
- Klimakompatibel: Vereinbar mit den Zielen des Klimaschutzes.
- Klimaneutrale Wettbewerbsfähigkeit: Die Fähigkeit eines Unternehmens oder einer Wirtschaft, im globalen Wettbewerb zu bestehen, während gleichzeitig die Klimaneutralität erreicht wird.
- Klimaresiliente Wettbewerbsfähigkeit: Die Fähigkeit eines Unternehmens oder einer Wirtschaft, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Kognitive Dissonanz: Ein psychischer Zustand, der entsteht, wenn eine Person gleichzeitig zwei oder mehr widersprüchliche Überzeugungen, Werte oder Einstellungen hat, was zu Unbehagen führt.
- Kohärent: Zusammenhängend, stimmig, widerspruchsfrei.
- Kolonialismus: Die Herrschaft eines Staates über andere Gebiete und Völker, oft verbunden mit Ausbeutung und Unterdrückung.
- Koloniale Kontinuitäten: Fortbestehende Muster oder Auswirkungen des Kolonialismus in der heutigen Zeit, auch nach der formalen Unabhängigkeit.
- Kontemplativ: Meditativ, nachdenklich, in die innere Betrachtung versunken.
- Kontingenz: Zufälligkeit, Unvorhersehbarkeit.
- Konversion: Umwandlung, Bekehrung zu einer anderen Überzeugung oder Lebensweise.
- Konversionslogik: Die Denkweise oder Argumentation, die auf eine Umwandlung oder Bekehrung abzielt.
- Konsensfähig: In der Lage, die Zustimmung oder den Konsens einer Gruppe zu finden.
- Konsumentensouveränität: Die Vorstellung, dass die Entscheidungen der Verbraucher auf dem Markt die Produktion und Allokation von Gütern bestimmen.
- Konsumkompetenz: Die Fähigkeit, bewusste und reflektierte Entscheidungen im Bereich des Konsums zu treffen.
- Konsumtive Normalität: Die gesellschaftlich als üblich oder selbstverständlich anerkannte Art und Weise des Konsumierens.
- Konsumzentriert: Primär auf Konsum ausgerichtet oder diesen betonend.
- Kultiviertes Fleisch: Fleisch, das in vitro aus Tierzellen gezüchtet wird, ohne dass ein Tier geschlachtet werden muss.
- Kulturell verankerte Deutungsrahmen: Tief in einer Kultur verwurzelte Interpretationsmuster, die die Wahrnehmung und Bewertung der Welt prägen.
- Kulturelle DNA: Die grundlegenden, tief verwurzelten Merkmale und Werte einer Kultur, die ihre Identität prägen.
- Kulturelle Intervention: Eingriffe in kulturelle Praktiken oder Normen, um Veränderungen zu bewirken.
- Kulturelle Normkritik: Die kritische Auseinandersetzung mit etablierten kulturellen Regeln und Verhaltensweisen.
- Kulturelle Sensibilität: Die Fähigkeit, die kulturellen Hintergründe und Besonderheiten anderer zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.
- Kulturhermeneutische Tiefenanalyse: Eine tiefgehende Interpretation kultureller Phänomene, die ihre verborgenen Bedeutungen und Zusammenhänge aufdeckt.
- Kultursensible Kommunikationsstrategien: Kommunikationsansätze, die auf die kulturellen Besonderheiten und Empfindlichkeiten der Zielgruppe abgestimmt sind.
- Laizistisch: Die Trennung von Kirche und Staat befürwortend.
- Latente Widerstände: Verborgen oder schlummernde Widerstände, die nicht offen zum Ausdruck kommen.
- Leistungsbezogene moralische Semantik: Eine moralische Sprache, die ethische Werte primär an Leistung und ökonomischen Erfolg knüpft.
- Level Playing Fields: Gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Akteure.
- Lineares Denken: Eine Denkweise, die Ursache und Wirkung in einer geradlinigen Abfolge sieht, ohne komplexe Rückkopplungen oder nicht-lineare Prozesse zu berücksichtigen.
- Machbarkeitsdenken: Eine Denkweise, die die Realisierbarkeit von Zielen und Maßnahmen betont.
- Marktarchitektur: Die strukturellen Rahmenbedingungen und Regeln, die das Funktionieren von Märkten bestimmen.
- Marktbasierte Transformationspfade: Wege des Wandels, die sich primär auf Marktmechanismen und wirtschaftliche Anreize stützen.
- Marktkonformität: Die Übereinstimmung mit den Regeln und Prinzipien der Marktwirtschaft.
- Marktorientierte Instrumente: Werkzeuge oder Maßnahmen, die auf den Prinzipien des Marktes basieren (z.B. Preise, Wettbewerb).
- Marktzentrumierung: Die Tendenz, den Markt als den zentralen Mechanismus für die Organisation von Gesellschaft und Wirtschaft zu betrachten.
- Minderung: Reduzierung, Verminderung, insbesondere von Treibhausgasemissionen.
- MINT-Bildung: Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
- Mischformen: Kombinationen von Elementen aus verschiedenen Denkmodellen.
- Monetarisierbar: In Geldwert umwandelbar oder bewertbar.
- Monokausal: Nur eine Ursache oder einen Faktor berücksichtigend.
- Moralische Dichte: Die Intensität oder Fülle moralischer Prinzipien und Werte in einem Denkmodell.
- Moralische Nische: Ein Bereich, in dem moralische Themen behandelt werden, ohne dass sie eine breitere strukturelle oder politische Relevanz erhalten.
- Moralische Zumutung: Eine ethische Forderung, die als anspruchsvoll oder belastend empfunden werden kann.
- Motivated Reasoning: Ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen Informationen so interpretieren, dass sie ihren bestehenden Überzeugungen oder Zielen entsprechen.
- Multiperspektivisch: Aus verschiedenen Blickwinkeln oder Perspektiven betrachtet.
- Narrative: Geschichten oder Erzählungen, die Sinn stiften und Identität prägen.
- Narrative Kohärenz: Die innere Stimmigkeit und logische Verbindung von Erzählungen oder Geschichten.
- Negative Emissionen: Technologien und Praktiken, die CO₂ direkt aus der Atmosphäre entfernen.
- Neoklassische Wirtschaftstheorie: Eine ökonomische Theorie, die sich auf das Verhalten von Individuen und Unternehmen auf Märkten konzentriert und oft von rationalen Entscheidungen ausgeht.
- Normative Begründung: Die Begründung von Regeln oder Handlungen auf der Grundlage moralischer oder ethischer Prinzipien.
- Normative Hierarchie: Eine Rangordnung von Werten oder Prinzipien, bei der einige als wichtiger oder übergeordnet angesehen werden als andere.
- Normative Rahmung: Die Einbettung von Themen oder Entscheidungen in einen Rahmen von moralischen Werten und Prinzipien.
- Normative Setzung: Die Festlegung von Werten oder Regeln, die als verbindlich oder wünschenswert angesehen werden.
- Normativer Imperativ: Eine moralische Forderung oder ein Gebot, das als unbedingt gültig und verpflichtend angesehen wird.
- Normativer Rückbau: Die bewusste Demontage oder Neudefinition von gesellschaftlich etablierten Normen, z.B. Konsumnormen.
- Normativer Zielhorizont: Eine übergeordnete Zielvorstellung, die moralisch begründet ist und die langfristige Ausrichtung von Handlungen oder Systemen bestimmt.
- Normativ-analytisch: Eine Methode, die sowohl normative (wertende) als auch analytische (beschreibende) Aspekte berücksichtigt.
- Normativ-begrenzende Funktion: Die Fähigkeit eines Konzepts, moralische Grenzen oder Beschränkungen zu setzen.
- Normativ-moralisch legitimiert: Durch moralische oder ethische Prinzipien gerechtfertigt oder als rechtmäßig anerkannt.
- Normierung: Der Prozess der Festlegung von Regeln, Standards oder Normen.
- Nutzungsmaximierung: Das Streben nach dem größtmöglichen Nutzen oder Gewinn.
- Ökologische Umkehr: Eine tiefgreifende Veränderung der Denk- und Handlungsweisen im Umgang mit der Umwelt, oft mit religiöser Konnotation.
- Ökologisches Gleichgewicht: Ein Zustand in der Natur, in dem die verschiedenen Komponenten eines Ökosystems stabil und ausgewogen sind.
- Ökospirituell: Eine Bewegung, die Spiritualität und ökologisches Bewusstsein miteinander verbindet.
- Ökumenische Organisationen: Organisationen, die die Zusammenarbeit und Einheit zwischen verschiedenen christlichen Kirchen fördern.
- Operationalisieren: Einen theoretischen Begriff in messbare oder handhabbare Indikatoren umwandeln.
- Opferkulte: Religiöse Praktiken, bei denen Opfer dargebracht werden, oft Tiere, um Gottheiten zu ehren oder zu besänftigen.
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen: Staatliche Regelungen und Gesetze zur Steuerung des Verhaltens von Individuen und Organisationen.
- Paternalistisch: Eine Haltung oder Politik, die darauf abzielt, für andere zu sorgen oder deren Entscheidungen zu beeinflussen, oft ohne deren volle Zustimmung, ähnlich einem Vater.
- Pfadabhängigkeiten: Historisch gewachsene Strukturen oder Entscheidungen, die zukünftige Entwicklungspfade stark beeinflussen oder einschränken.
- Pflanzenbasierte Ernährung: Eine Ernährungsweise, die primär auf pflanzlichen Produkten basiert und tierische Produkte weitgehend oder vollständig meidet.
- Pluralität: Vielfalt, Mehrzahl von Elementen oder Perspektiven.
- Pluralismusforschung: Forschung, die die Vielfalt von Meinungen, Werten und Interessen in einer Gesellschaft untersucht.
- Polarisierung: Die zunehmende Spaltung einer Gesellschaft oder Gruppe in gegensätzliche Lager.
- Policy Instruments: Politische Werkzeuge oder Maßnahmen, die zur Erreichung bestimmter Ziele eingesetzt werden.
- Policy-relevant but not policy-prescriptive: Wissenschaftliche Erkenntnisse oder Berichte, die für die Politik relevant sind, aber keine konkreten politischen Maßnahmen vorschreiben.
- Politisch gebändigtes Policy-Manual: Ein politisches Dokument, das eher eine Ansammlung von verwaltbaren Maßnahmen als eine visionäre Strategie darstellt.
- Politische Kontingenz: Die Unvorhersehbarkeit oder Zufälligkeit politischer Entscheidungen und Entwicklungen.
- Politische Psychologie: Ein Forschungsfeld, das psychologische Faktoren in politischen Prozessen untersucht.
- Politische Rahmung: Die Art und Weise, wie politische Themen oder Entscheidungen in einen bestimmten Kontext gestellt und interpretiert werden.
- Politische Verhandlungslogik: Die Prinzipien und Dynamiken, die politische Verhandlungsprozesse bestimmen, oft geprägt von Kompromissen und Machtinteressen.
- Populärwissenschaftliche Vermittlung: Die Darstellung wissenschaftlicher Inhalte in einer allgemein verständlichen und ansprechenden Form für ein breites Publikum.
- Postkolonial: Die Zeit nach der Kolonialherrschaft oder Theorien, die sich mit den Auswirkungen des Kolonialismus auseinandersetzen.
- Postmaterielle Narrative: Erzählungen, die Werte jenseits des materiellen Besitzes und Konsums betonen, z.B. Lebensqualität, Gemeinschaft oder Umweltschutz.
- Pragmatische Öffnung: Eine Haltung, die sich flexibel und lösungsorientiert an die Realität anpasst, ohne starre Prinzipien zu verfolgen.
- Primat des Marktes: Die Vorstellung, dass der Markt der übergeordnete Mechanismus für die Allokation von Ressourcen und die Steuerung der Wirtschaft sein sollte.
- Profitabilität: Die Fähigkeit, Gewinne zu erzielen.
- Programmatische Selbstverortung: Die Darstellung der eigenen Ziele und Prinzipien in einem Programm oder Manifest.
- Prophetische Traditionen: Religiöse Überlieferungen, die sich auf Propheten beziehen, die oft soziale oder moralische Kritik üben und zur Umkehr aufrufen.
- Qualitative Inhaltsanalyse: Eine Forschungsmethode zur systematischen Auswertung von Texten, um deren Inhalte und Bedeutungen zu interpretieren.
- Qualitative Interviews: Eine Forschungsmethode, bei der offene Fragen gestellt werden, um tiefe Einblicke in Meinungen und Erfahrungen zu gewinnen.
- Quantifizierbar: Messbar, in Zahlen ausdrückbar.
- Quasireligiöser Wahrheitsanspruch: Eine Behauptung, die trotz fehlender empirischer oder rationaler Beweise mit einer fast religiösen Überzeugung als Wahrheit vertreten wird.
- Radikale Systemkritik: Eine grundlegende und umfassende Kritik an den fundamentalen Strukturen eines Systems, die über einzelne Reformen hinausgeht.
- Rationale Anreize: Anreize, die auf die Vernunft und das Eigeninteresse von Individuen abzielen, um deren Verhalten zu beeinflussen.
- Rationale Selbstermächtigung: Die Befähigung zur Gestaltung der eigenen Zukunft und Gesellschaft durch Vernunft und Einsicht.
- Rationalitätskalkül: Die Berechnung oder Abwägung von Entscheidungen auf der Grundlage rationaler Überlegungen, oft im Sinne von Kosten-Nutzen-Analysen.
- Rebound-Effekte: Negative Effekte, die durch die Verhaltensänderung der Nutzer nach der Einführung von Effizienzsteigerungen entstehen und die beabsichtigte Einsparung teilweise oder ganz aufheben.
- Reaktualisierung: Die Erneuerung oder Neubelebung von Konzepten, Ideen oder Praktiken in einem neuen Kontext.
- Reduktionismus: Die Tendenz, komplexe Phänomene auf einfachere Elemente oder Ursachen zu reduzieren, wodurch ihre Komplexität vernachlässigt wird.
- Reducetarian-Ansatz: Eine Ernährungsweise, die darauf abzielt, den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren, ohne ihn vollständig zu eliminieren.
- Reflexive Modernisierung: Eine Theorie, die besagt, dass die Moderne sich selbst kritisch hinterfragt und Risiken, die sie selbst erzeugt hat, bearbeitet.
- Regulativ: Regulierend, steuernd, vorschreibend.
- Rekonstruieren: Neu aufbauen, wiederherstellen oder aus Fragmenten zusammensetzen.
- Relationale Ausrichtung: Eine Orientierung, die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Elementen betont.
- Relative Entkopplung: Das Ziel, den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung pro Produktionseinheit zu senken, während das Wirtschaftswachstum beibehalten wird.
- Relativieren: Die Bedeutung oder Gültigkeit von etwas einschränken oder in Bezug auf etwas anderes sehen.
- Religionismus: Die Ausweitung religiöser Kategorien zur Deutung und Normsetzung im gesellschaftlichen Kontext.
- Reproduktionsethische Fragen: Ethische Fragen, die sich auf die Fortpflanzung und Familienplanung beziehen.
- Repräsentativität: Die Eigenschaft, eine größere Gruppe oder Stichprobe in wichtigen Merkmalen widerzuspiegeln.
- Resilienzmodelle: Modelle, die die Fähigkeit von Systemen beschreiben, Krisen zu überstehen und sich anzupassen.
- Resonanzbeziehungen: Ein Konzept von Hartmut Rosa, das eine lebendige, wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Welt beschreibt, in der sich beide gegenseitig berühren und antworten.
- Resonanzpotenziale: Das Potenzial einer Idee oder eines Konzepts, bei Menschen Anklang zu finden und emotionale oder intellektuelle Reaktionen hervorzurufen.
- Rigorismus: Strenge oder Unnachgiebigkeit in moralischen oder prinzipiellen Fragen.
- Ritueller Aktionismus: Handlungen, die zwar symbolisch bedeutsam sind, aber keine tiefgreifenden Veränderungen bewirken.
- Säkular: Weltlich, nicht religiös oder kirchlich gebunden.
- Säkularer Ethikansatz: Eine ethische Begründung, die ohne Bezug auf Religion oder Transzendenz auskommt.
- Schöpfungsbewahrung: Das theologische Konzept der Verantwortung des Menschen für den Schutz und Erhalt der von Gott geschaffenen Natur.
- Schuldadressierung: Das Zuweisen von Schuld oder Verantwortung an bestimmte Akteure.
- Schulverpflegung: Die Versorgung mit Essen in Schulen.
- Selektive Anschlussfähigkeit: Die Fähigkeit eines Modells, nur bestimmte Aspekte oder Anforderungen zu integrieren, während andere ausgeschlossen werden.
- Selektive Modernisierungsbereitschaft: Die Bereitschaft, nur bestimmte Bereiche oder Themen zu modernisieren, während andere traditionell bleiben.
- Selektive Rationalität: Eine Form der Rationalität, die nur bestimmte Aspekte oder Informationen berücksichtigt, während andere ausgeblendet werden.
- Selbstentmächtigung: Der Prozess, bei dem sich eine Person oder Gruppe selbst die Fähigkeit abspricht, Einfluss zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen.
- Selbstvergewisserung: Das Suchen nach Bestätigung oder Klarheit über die eigene Identität, Überzeugungen oder Positionen.
- Semantik: Die Lehre von der Bedeutung von Wörtern und Sätzen.
- Semantische Präferenzen: Bevorzugte Bedeutungen oder Interpretationen von Begriffen und Konzepten.
- Sinnstiftung: Das Schaffen von Bedeutung oder Zweck im Leben.
- Situatives Datenmaterial: Daten, die in einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Kontext erhoben wurden und deren Übertragbarkeit begrenzt sein kann.
- Skalierbarkeit: Die Fähigkeit, in größerem Umfang angewendet oder umgesetzt zu werden.
- Skalierende Strukturierung: Eine Methode, bei der Aussagen nach ihrer Ausprägung auf einer Skala bewertet werden, um Vergleiche zu ermöglichen.
- Sozial eingebettetes Verantwortungsprinzip: Ein Prinzip, das Verantwortung nicht isoliert, sondern als Teil sozialer Beziehungen und Strukturen versteht.
- Soziale Akzeptanz: Die Zustimmung oder Duldung einer Idee, Praxis oder Gruppe durch die Gesellschaft.
- Soziale Abgrenzungsangst: Die Furcht davor, von anderen sozial ausgeschlossen oder isoliert zu werden.
- Soziale Diversität: Die Vielfalt von Merkmalen, Identitäten und Erfahrungen innerhalb einer Gesellschaft.
- Soziale Entlastung: Die Reduzierung von psychischem oder sozialem Druck durch die Verlagerung von Verantwortung oder die Akzeptanz von Verhaltensweisen, die nicht vollständig den eigenen Normen entsprechen.
- Soziale Exklusivität: Die Eigenschaft, bestimmte Gruppen von der Teilnahme an sozialen Aktivitäten oder dem Zugang zu Ressourcen auszuschließen.
- Soziale Ungleichheit: Die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Chancen und Macht in einer Gesellschaft.
- Sozialethisch orientiert: Eine Ausrichtung, die moralische Prinzipien auf soziale Fragen anwendet.
- Sozio-ökonomisch: Soziale und wirtschaftliche Aspekte betreffend.
- Speziesgrenze: Die Grenze zwischen verschiedenen biologischen Arten.
- Spirituelle Rückversicherungen: Handlungen oder Überzeugungen, die dazu dienen, die eigene spirituelle Sicherheit zu gewährleisten, oft als Reaktion auf Ängste oder Unsicherheiten.
- Spirituelle Tiefe: Eine tiefe, oft mystische oder erfahrungsbezogene Dimension von Spiritualität.
- Standardisiert: Nach festen Regeln oder Normen vereinheitlicht.
- Strukturell eingebettet: Tief in den Strukturen oder Systemen verankert.
- Strukturelle Anschlussfähigkeit: Die Fähigkeit eines Denkmodells, sich an bestehende gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Strukturen anzupassen oder diese zu beeinflussen.
- Strukturelle Bedingtheit: Die Tatsache, dass Verhalten und Entscheidungen durch übergeordnete Strukturen und Rahmenbedingungen beeinflusst werden.
- Strukturelle Konsistenz: Die innere Stimmigkeit und Kohärenz der Strukturen eines Systems.
- Strukturimmanente Schwächungen: Schwächen, die aus den grundlegenden Strukturen oder Prinzipien eines Denkmodells selbst entstehen.
- Stufenzielen: Ziele, die in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen erreicht werden sollen.
- Suffizienz (Suffizienzethik): Eine Ethik des Genügens, die darauf abzielt, den Ressourcenverbrauch durch eine Reduzierung des Konsums und eine Veränderung des Lebensstils zu verringern.
- Synkretistisch: Eine Vermischung oder Verschmelzung von verschiedenen religiösen, philosophischen oder kulturellen Elementen.
- Synthetische Reflexion: Eine Zusammenfassung und tiefgehende Betrachtung von Erkenntnissen, die zu einer neuen, umfassenderen Einsicht führt.
- Systemaffirmativ: Die bestehenden Systeme bejahend oder stützend.
- Systemimmanent: Innerhalb eines Systems oder dessen Logik verbleibend.
- Systemische Blockaden: Hindernisse oder Widerstände, die in den Strukturen eines Systems selbst verankert sind.
- Systemische Entschleunigung: Eine bewusste Verlangsamung von Prozessen und Entwicklungen auf systemischer Ebene.
- Systemische Rahmung: Die Betrachtung von Problemen oder Phänomenen innerhalb eines umfassenden systemischen Kontextes, der alle relevanten Beziehungen und Wechselwirkungen berücksichtigt.
- Systemische Steuerung: Die Lenkung von komplexen Systemen durch gezielte Eingriffe in deren Strukturen und Prozesse.
- Systemtheoretisch: Auf der Grundlage der Systemtheorie basierend, die Systeme als Ganzheiten betrachtet und deren Beziehungen und Wechselwirkungen analysiert.
- Technokratisch: Eine Denkweise, die Probleme primär durch technische Lösungen und Expertentum angeht, oft unter Vernachlässigung sozialer oder politischer Aspekte.
- Technologieoffenheit: Eine Haltung, die verschiedene technologische Ansätze zur Lösung eines Problems zulässt und nicht auf bestimmte Technologien beschränkt ist.
- Technologietransfer: Die Übertragung von Wissen, Technologien oder Fähigkeiten von einem Akteur zu einem anderen, oft zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern.
- Theoretisch fundiert: Auf einer soliden theoretischen Grundlage basierend.
- Theoriebildend: Darauf abzielend, neue Theorien oder Modelle zu entwickeln.
- Theoriegeleitet: Von einer bestimmten Theorie oder theoretischen Annahme geleitet.
- Thematisierung: Das Ansprechen oder Bearbeiten eines Themas.
- Tierethisch: Ethische Fragen betreffend, die den Umgang des Menschen mit Tieren betreffen.
- Tierleid: Das Leiden von Tieren.
- Tonalität: Die Art und Weise, wie eine Botschaft formuliert oder vermittelt wird, einschließlich des emotionalen Untertons.
- Tradierte Deutungsmuster: Überlieferte oder traditionelle Interpretationsmuster.
- Transdisziplinär: Über die Grenzen einzelner wissenschaftlicher Disziplinen hinausgehend und verschiedene Wissensbereiche integrierend.
- Transformation light: Eine oberflächliche oder unzureichende Form der Transformation, die keine grundlegenden Veränderungen bewirkt.
- Transformationsforschung: Ein Forschungsfeld, das sich mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen auseinandersetzt.
- Transformationskompetenz: Die Fähigkeit, Transformationsprozesse zu verstehen, zu gestalten und zu begleiten.
- Transformationsnarrativ: Eine Erzählung, die einen tiefgreifenden Wandel und dessen Vision beschreibt.
- Transformationspotenzial: Das Potenzial für tiefgreifende Veränderungen in Strukturen, Prozessen oder Denkweisen.
- Transformationsprozesse: Tiefgreifende Veränderungen in Systemen oder Gesellschaften.
- Transformative Bildung: Eine Form der Bildung, die darauf abzielt, grundlegende Veränderungen im Denken und Handeln zu bewirken, um komplexe Probleme anzugehen.
- Transformative Klimapolitik: Eine Klimapolitik, die auf tiefgreifende Veränderungen der Gesellschaft und Wirtschaft abzielt, um die Klimakrise zu bewältigen.
- Transzendente Begründungsstruktur: Eine Begründung oder Legitimation, die sich auf übernatürliche oder jenseits der materiellen Welt liegende Instanzen bezieht.
- Transzendenter Horizont: Ein Bereich, der über die erfahrbare Welt hinausgeht, oft in religiösen oder philosophischen Kontexten.
- Übergangssicherheit: Die Gewährleistung von Stabilität und Kontinuität während eines Übergangs oder Wandels.
- Umverteilung von Ressourcen: Die Neuverteilung von materiellen oder immateriellen Gütern in einer Gesellschaft.
- Umweltökonomik: Ein Fachgebiet, das sich mit den Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Umwelt befasst.
- Umweltschäden entziehen sich exakter Bepreisung: Die Schwierigkeit, den monetären Wert von Umweltschäden genau zu bestimmen und sie in Marktpreise zu integrieren.
- UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change): Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, die einen globalen Rahmen für die Zusammenarbeit im Klimaschutz schafft.
- UNEP (Umweltprogramm der Vereinten Nationen): Eine Organisation der Vereinten Nationen, die globale Umweltfragen behandelt und nachhaltige Entwicklung fördert.
- Unmittelbare Handlungsmotivation: Eine sofortige Bereitschaft oder Antrieb zum Handeln.
- Unterschätzung struktureller Trägheit: Die Neigung, die Beharrungskraft und Widerstände bestehender Strukturen zu unterschätzen.
- Utopien: Idealvorstellungen von einer besseren Gesellschaft oder Zukunft, die oft nicht sofort realisierbar erscheinen.
- Verhaltenswirksame Deutungsmuster: Interpretationsmuster, die das Verhalten von Menschen beeinflussen oder steuern.
- Verlustängste: Ängste vor dem Verlust von Besitz, Status, Sicherheiten oder vertrauten Lebensweisen.
- Vernunftbasiert: Auf Vernunft und logischem Denken beruhend.
- Vieldeutigkeit: Die Eigenschaft, mehrere Interpretationen oder Bedeutungen zuzulassen.
- Vielstimmig: Durch viele verschiedene Stimmen oder Perspektiven geprägt, nicht monolithisch.
- Wachstumsdogma: Die unkritische Annahme, dass Wirtschaftswachstum stets positiv und notwendig ist.
- Wachstumsfreundlich: Eine Haltung, die Wirtschaftswachstum befürwortet und fördert.
- Wachstumsimperativ: Die Notwendigkeit oder der Zwang zu kontinuierlichem Wirtschaftswachstum.
- Wachstumsverträglich: Kompatibel mit dem Wirtschaftswachstum.
- Wahrnehmungsfilter: Psychologische Mechanismen, die die Art und Weise beeinflussen, wie Informationen wahrgenommen und interpretiert werden.
- Weiche Faktoren: Aspekte, die schwer zu quantifizieren oder zu messen sind, wie Emotionen, kulturelle Werte oder soziale Normen.
- Wertesysteme: Eine Sammlung von miteinander verbundenen Werten, die die Grundlage für Entscheidungen und Verhalten bilden.
- Wirkungsstudien: Studien, die die Effekte oder Auswirkungen von Maßnahmen oder Interventionen untersuchen.
- Wirtschaftsökonomische Rahmung: Die Einbettung von Themen oder Problemen in einen wirtschaftlichen Kontext, der primär ökonomische Kriterien und Logiken anwendet.
- Wirtschaftsverträglich: Mit den Prinzipien und Zielen der Wirtschaft vereinbar.
- Wissenschaftsbasierte Orientierung: Eine Ausrichtung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden beruht.
- Wohlstandsbegriffe: Konzepte oder Definitionen von Wohlstand, die über rein materielle Aspekte hinausgehen können.
- WCRP (World Climate Research Programme): Weltklimaforschungsprogramm, eine internationale Forschungsorganisation zur Koordination der Klimaforschung.
- Zero Waste: Eine Lebensphilosophie, die darauf abzielt, die Müllproduktion so weit wie möglich zu reduzieren, um Abfall zu minimieren.
- Zielkonfliktfähigkeit: Die Fähigkeit eines Denkmodells, konkurrierende Ziele zu erkennen, zu benennen und konstruktiv zu bearbeiten, ohne sie zu verdrängen oder vereinfacht aufzulösen.
- Zielpriorisierung: Die Festlegung einer Reihenfolge von Zielen nach ihrer Wichtigkeit.
- Zielverantwortung: Die Zuschreibung von Verantwortung für das Erreichen bestimmter Ziele an spezifische Akteure oder Instanzen.
- Zumutbarkeit: Die Frage, inwieweit eine Forderung oder Maßnahme einer Person oder Gruppe zugemutet werden kann, ohne sie übermäßig zu belasten.
- Zweckrationalität: Eine Form der Rationalität, die sich auf die effiziente Auswahl von Mitteln zur Erreichung gegebener Ziele konzentriert, ohne die Ziele selbst kritisch zu hinterfragen.
Martin Gertler promovierte interdisziplinär 1999 zur Rezeption einer TV-Sendereihe und 2025 zur Meinungsbildung in der Klimakrise durch weltanschaulich bestimmte Denkmodelle (dieses Buch). 2002 wurde er Professor für Mediengestaltung, Medienproduktion, Medientheorien und Rezeptionsforschung, 2008 zusätzlich Professor für Kommunikationswissenschaft und Gründungsrektor einer weiterbildenden Universität. Seit 2011 begleitet er vorwiegend berufsbegleitende Promovierende an internationalen Universitäten.
0Noch keine Kommentare
Seitenüberblick
Klimakrise als Glaubenssache: Start
Aktuelles, Vorwort, Weg der Untersuchung und Video- und Audio-ElementeMit dem Buch arbeiten
Inhaltliche Kurzfassung und häufige Fragen (FAQ) zum BuchNachschlagen
Zeittafel der Geschehnisse und aller im Buch vorkommende PersonenVertiefungen
Hauptthesen, Schlüsselkonzepte, Übungsfragen, Essay-Aufgaben und Glossar
Das Buch ist verfügbar.
Die Website glaubenssache-klimakrise.de ist ein Angebot von
Prof. Martin Gertler, PhD ©2025